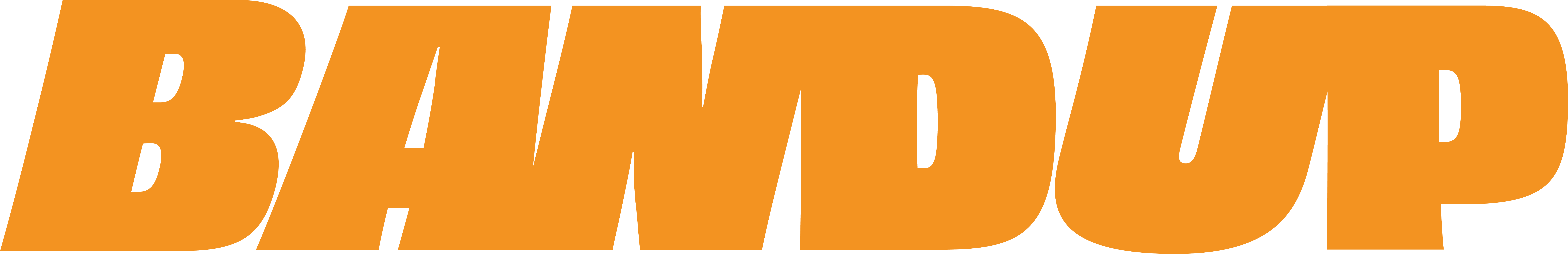Definition "Marsch" Musiktheorie verstehen

Definition: Was bedeutet "Marsch" ?
Der Begriff „Marsch“ besitzt mehrere Bedeutungen, die je nach Kontext variieren. In der Musik bezeichnet ein Marsch ein charakteristisches Musikstück, das durch einen klaren, geraden Takt und ausgeprägte metrische Akzente das Marschieren im Gleichschritt unterstützt. Diese Form der Marschmusik ist darauf ausgelegt, das Gehen und die Bewegung einer Gruppe im Gleichschritt zu erleichtern und findet sich häufig bei militärischen Aufzügen, Paraden oder festlichen Zeremonien.
Im militärischen Sprachgebrauch steht „Marsch“ für die organisierte Fortbewegung von Truppen zu Fuß über längere Strecken, oft als Teil von Übungen oder Einsätzen. Hierbei ist der Gleichschritt ein zentrales Element, das durch den Rhythmus der Marschmusik zusätzlich gefördert wird.
Geografisch gesehen bezeichnet eine „Marsch“ ein fruchtbares Schwemmland, das sich vor allem an der Nordseeküste findet. Diese Marschen sind durch Deiche geschützt und zeichnen sich durch ihre besondere Bodenbeschaffenheit aus, die durch Ablagerungen von Flüssen und das Meer entstanden ist. In diesem Zusammenhang ist die Marsch ein wichtiger Teil der norddeutschen Landschaft und Landwirtschaft.
Zusammengefasst umfasst die Bedeutung des Begriffs „Marsch“ sowohl das Musikstück und die Bewegung im Gleichschritt, als auch das Schwemmland an der Nordseeküste und die Fortbewegung zu Fuß – sei es im militärischen, geografischen oder alltäglichen Kontext.
Marsch - Dieser aus der Musiktheorie stammende Terminus leitet sich aus dem französischen Sprachgebrauch ab und bedeutet das Folgende, siehe hier: marche, wörtlich: marschieren. Das von dem lateinischen Verb „marcare“ abgeleitete althochdeutsche Wort „markon“ entstammt dem Jägerlatein und bedeutet in etwa so viel wie: „Durch festes Stampfen eine Fährte hinterlassen.“ Das Wort 'Marsch' bezieht sich dabei auf das Gehen mit den Füßen im Gleichschritt, wobei das stampfende Schreiten besonders betont wird. Gemeint ist somit die Bezeichnung für ein Musikstück, durch welches „das Gehen im Gleichschritt“ erleichtert wird. Die entsprechende Musikgattung bezeichnet man als Marschmusik, deren Rhythmus eng mit den gleichmäßigen Schritten der Marschierenden verbunden ist.
Du möchtest dein Wissen in die Tat umsetzen? Finde jetzt Stimmübungen und Kurse um deinen Gesang zu verbessern.
Ausführliche Definition im BANDUP-Lexikon
Eine Marschmusik zeichnet sich durch gleichmäßige, metrische Akzente in geraden Zählzeiten aus, wie z.B. den folgenden: 2/4 Takt, 2/2 Takt, 4/4 Takt. Dadurch ist eine klare Vorgabe gegeben, die das Marschieren im Gleichschritt gewährleistet. Märsche werden häufig von einer Militärkapelle gespielt, um den Rhythmus für die Truppe und die Soldaten zu geben, insbesondere bei militärischen Fußmärschen. Der Marsch in der Militärmusik war gerade deshalb besonders erfolgreich. Bei längeren Fußmärschen, insbesondere im Militär, spielen das Marschgepäck und die Marschverpflegung eine wichtige Rolle, da Soldaten ihr Gepäck selbst tragen müssen. Im Vergleich zu zivilen Wanderungen, bei denen der Fokus auf Naturerlebnis und Erholung liegt, sind militärische Märsche durch strenge Organisation, Disziplin und die Anforderungen an die Truppe und das Militär geprägt. Eine Sonderform der Marschmusik weist jedoch einen punktierten Rhythmus auf. Dazu gehören Märsche aus der Zeit der Französischen Revolution, wie z.B. die Nationalhymne Frankreichs „Marseillaise“, aber auch Ballettmusik.
Der in der Kunstmusik enthaltene traditionelle Marsch, so wie er in Opern und Klavierstücken vorkommt, ist der Form nach der alten Tanzmusik angemessen. Er setzt sich aus zwei Reprisen zusammen, die aus einer Länge von acht bis sechzehn Takten besteht. Der heutige in Liedform gehaltene Marsch ist auch zweiteilig und er umfasst dieselbe Länge. Der zweite Teil ist oft umfangreicher. Seit dem 18. Jahrhundert wurde in einen solchen zweiteiligen Marsch ein Zwischenteil integriert, der als „Trio“ bezeichnet wurde und meist in der Subdominante auskomponiert war. Dadurch hob sich dieser Satz im Vergleich zu den anderen beiden ab. Später wurde diese Form noch dazu durch einen Generalauftakt von vier bis sechzehn Takten ergänzt.
Instrumentierung
Bereits im 16. Jahrhundert gebrauchte man Instrumente wie Trommeln, Pauken, Trompeten und Schweizerpfeifen, z.B. dann, wenn der Feldmarschall in die Schlacht zog. Außerdem werden bis heute überwiegend Blasinstrumente zum Einsatz gebracht, vor allem Blechblasinstrumente, deren Schalltrichter beim Spielen nach vorne gerichtet sind. (Siehe: Substitutionsinstrumente) Dabei wurde das Waldhorn durch das Mellophon ausgetauscht oder die Tuba durch das Helikon und Sousaphon. (Siehe auch: engl. „marching brass-Version“)
Würdest du auch gern ein Blasinstrument spielen wollen? Dann beginne hier gleich heute damit und finde heraus, welches Instrument zu dir passt.
Seit dem 19. Jahrhundert konnte in Ländern wie Italien und Frankreich auch die Orgel für Marschmusik zum Einsatz gebracht werden; vor allen dann, wenn feierliche Prozessionen abgehalten wurden. Seit dieser Zeit nämlich wurden populäre Elemente aus der profanen Musikszene in die geistliche Musikwelt integriert.
Ursprung der Märsche
Alle festlichen Aufzüge wurden von alters her mit Musik begleitet. In der griechischen Tragödie gewann die Marschmusik an Bedeutung, da der Chor die Marschbewegung während des singenden Auf- und Abtritts übernahm. Einem Bericht des griechischen Geschichtsschreibers Thukydides zufolge, wurde die antike Kriegsführung von Marschmusik begleitet. Als die Spartaner in die Schlacht von Mantineia zogen, vollzogen sie das unter dem musikalischen Einsatz von einer Gruppe Auleten, um die Krieger zu unterstützen, gleichmäßig in ein und demselben Takt zu marschieren. Die Vorläufer des modernen Marsches stellten sowohl Prozessionsgesänge als auch Lieder der Kreuzfahrer und Landsknechte dar.
Eine indirekte Quelle, die für militärische Marsch-Praktiken der Renaissance steht, ist ein Manuskript des englischen Komponisten William Byrd. Es enthält Musik für Tasteninstrumente wie das dem Cembalo-verwandten Virginal. Unter dem Titel „The Battle for Virginal“ aus „My Ladye Nevells Book“ erlangte es einen hohen Bekanntheitsgrad. Darin sind vier Stücke enthalten, die ausschließlich als Marsch (franz. marche) bezeichnet wurden. Der deutsche Militärmarsch aus der Zeit Friedrich II. und später aus der Zeit der Befreiungskriege, trat in unterschiedlichen Formen hervor, und zwar:
- in Form eines Parademarschs (frz. Pas ordinaires),
- eines Präsentiermarschs,
- eines Geschwindmarschs (frz. Pas redoublés, Quick march),
- als Sturmmarsch (frz. Pas de charge)
- und als Reiter- und Regimentsmarsch.
Märsche in der Oper
Betrachtet man die Kunstmusik ist zu beobachten, dass in der Oper des 17. und 18. Jahrhunderts die Märsche nicht nur in militärisch-kriegerischem Sinn Anwendung fanden, sondern als Begleitmusik des Einzugs von Priestern, Hirten, Matrosen oder extravaganter Volksgruppen wie z.B. der Perser. Instrumentierung, Tempo und Charakter der Musik wurden dann der jeweiligen Bedeutung angepasst und in diesem speziellen Sinn angemessen dargeboten. Außerdem wurden sie in skurrilem Sinn gebraucht.
Als Beispiel dafür soll der „Marsch für die türkische Zeremonie“ (frz. „Marche pour la cérémonie des Turcs“) des Komponisten Jean-Baptiste Lully genannt sein, der in Molières Komödie „Der Bürger als Edelmann“ dem Zwecke der Verballhornung dient. Im 19. Jahrhundert traten innerhalb der Oper von Georges Bizets „Carmen“ gleich zwei Märsche mit unterschiedlicher Ausdruckskraft hervor: Zum einen der „Marsch des Toreros“ (franz. „Marche des Toréadors“) und zum anderen der „Marsch der Schmuggler“ (franz. „Marche des Contrebandiers“) Die Instrumentierung des zweiten Marsches ist im Gegensatz zu dem zuerst erwähnten schmal.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Was ist der Grund dafür? Die Schmuggler schleichen sich heimlich, auf leisen Fußsohlen, aber doch ein und desselben Schrittes davon. Hier wird ein großer Gegensatz der beiden Märsche deutlich. Der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart wurde für seine vielen Orchester-Märsche für Serenaden und Divertimenti bekannt. Eine besonders witzige Instrumentierung stellt der Marsch KV 335 Nr. 1 dar. Während nämlich die Oboe solistisch hervorgehoben wird, greifen die Streicher ein und zupfen ihre Saiten gleich einer einheitlich im Takt tickenden Uhr.
Märsche im 19. und frühen 20. Jahrhundert
Der Marsch mit seinen nationalistischen und militärischen Tendenzen erfuhr im 19. und frühen 20. Jahrhundert seine Blütezeit. Fürsten wurden dadurch gebührend gewürdigt, z.B. durch Gioachino Rossini, der eine Vorliebe für Märsche hatte und dadurch großes Ansehen erlangte. Dabei war der „Marsch für den Sultan“ (ital. „Marcia per il Sultano“) eine Auftragskomposition, die auch noch heute immer wieder von italienischen Militärkapellen bevorzugt zur Aufführung gelangt.
Nicht zuletzt sei die Familie Strauss in Wien genannt, die jede passende Gelegenheit nutzte, um einen Marsch zu komponieren. Dadurch wurde entweder Patriotismus oder Kaisertreue demonstriert, oder es wurden Persönlichkeiten in militärisch hohem Rang geehrt. Hierbei ist der „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauss (Vater) maßgeblich. Kompositionen, die für den Einzug (frz. Entrée) oder Auszug (frz. Sortie) bestimmt sind, weisen immer einen marschähnlichen Charakter auf. Es gibt Festmärsche, Huldigungsmärsche, Sakrale Märsche und viele weitere. Als besonderer Marsch sei der Trauermarsch (frz. Marcia funebre) erwähnt. Außerdem gibt es Lieder, deren Form marschartig ist und die sich wegen ihrer Instrumentierung besonders für Promenadenmärsche eignen.
Musikalische Struktur eines Marsches
Die musikalische Struktur eines Marsches ist gezielt darauf ausgerichtet, das Marschieren und die Bewegung im Gleichschritt zu unterstützen. Typischerweise ist ein Marsch in einem geraden Takt wie 2/4, 2/2 oder 4/4 gehalten, was einen gleichmäßigen Rhythmus und eine klare metrische Gliederung ermöglicht. Diese Taktarten sorgen dafür, dass die Schritte der Marschierenden exakt auf die Musik abgestimmt werden können.
Ein klassischer Marsch besteht meist aus mehreren Teilen: Das Hauptthema eröffnet das Musikstück und gibt den charakteristischen Rhythmus vor. Es folgt häufig ein Trio, das sich durch eine andere Tonart und einen weicheren Charakter abhebt und so einen musikalischen Kontrast schafft. Der Schlussteil bringt das Musikstück oft mit einer Wiederholung des Hauptthemas oder einer Steigerung zum Abschluss.
Die Instrumentierung eines Marsches ist ein weiteres zentrales Merkmal. Besonders Blasinstrumente, vor allem Blechblasinstrumente, prägen den Klang und unterstreichen den marschähnlichen Charakter. Je nach Anlass und Form des Marsches können auch Schlaginstrumente, Holzbläser oder sogar Orgeln zum Einsatz kommen.
Durch diese spezielle musikalische Form und die klare Gliederung in verschiedene Teile wird der Marsch zu einem Musikstück, das nicht nur das Marschieren im Gleichschritt erleichtert, sondern auch in der Blasmusik, bei Paraden, in der Militärmusik und bei festlichen Anlässen eine zentrale Rolle spielt. Die Struktur eines Marsches spiegelt somit die Bewegung und den Rhythmus wider, die für das Marschieren und das gemeinsame Gehen einer Gruppe von Menschen charakteristisch sind.
Du möchtest mehr Definitionen aus der Musiktheorie lernen? Dann stöbere jetzt in unserer Kategorie zum großen Musiklexikon.